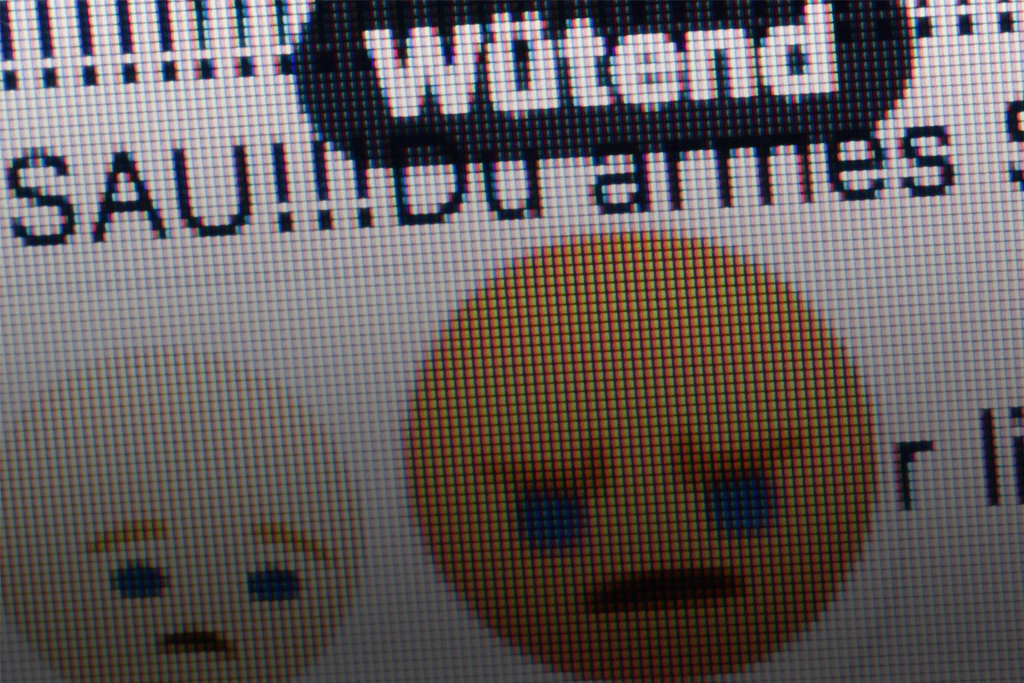Desinformationen oder Hass im Netz nehmen auch im Kontext der Bundestagswahl verstärkt zu. Doch was unternehmen die großen Parteien bis September und in der nächsten Legislaturperiode? Ein Blick auf ihre Vorhaben zeigt: Es gibt nur wenig Einigkeit.
Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (1. Juni 2019) war der traurige Höhepunkt einer sichtbaren Zunahme von Hass und Hetze im Netz. Mit einem Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität wollte die Bundesregierung eine direkte Antwort geben. Doch erst in diesem Jahr wurden nach langwierigen parlamentarischen Auseinandersetzungen zwei Gesetze verabschiedet und mit der Einrichtung der „Zentralen Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet“ beim Bundeskriminalamt (BKA) begonnen. Letztere soll die von den Plattformen gemeldeten Identifikationsdaten zu den als potenziell strafbar eingestuften Inhalten überprüfen. Damit ist allerdings nur ein erster Schritt getan. Wichtiger ist daher die Frage, wie es jetzt weitergehen soll. Auf europäischer Ebene wird am Digital Service Act gearbeitet – dessen Regeln werden aber erst in einigen Jahren zur Anwendung kommen. Mit Blick auf den anstehenden Wahlkampf und die nächste Legislatur stellt sich daher die Frage: Was haben die Parteien vor?
Rechtliche Maßnahmen gegen Hate Speech (Linksammlung)
Keine gemeinsame Selbstverpflichtung
Der Parteirat von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat am 10. Mai eine Selbstverpflichtung für einen fairen Bundestagswahlkampf beschlossen. Darin heißt es, man wolle die Demokratie „gegen intransparente Beeinflussungsversuche und Angriffe auf den Wahlprozess und Wahlkampf“ verteidigen. Konkret soll dies unter anderem durch die Kenntlichmachung der eigenen Urheberschaft, die Freigabe des Zugangs zu Daten der Werbebuchungen, eine Beschränkung des Targetings auf die Merkmale Alter, Ort, Geschlecht und Interessen, die Nichtverwendung sensibler persönlicher Informationen zur Profilierung, die konsequente Anzeige strafbarer Kommentare sowie die Überprüfung von Meldungen auf ihren Wahrheitsgehalt gelingen. Auch die SPD hat mittlerweile „Acht Punkte für Fairness im digitalen Wahlkampf“ erarbeitet, in denen sie sich neben weiteren Punkten vor allem zu Transparenz bei der Werbung in sozialen Medien, zum Verzicht auf manipulative Mittel wie Fake-Likes und zu den europäischen und deutschen Datenschutzstandards bekennt. Damit haben beide Parteien ihre Selbstverpflichtungen vom letzten Bundestagswahlkampf 2017 nochmals erheblich ausgeweitet. Während DIE LINKE nachziehen will, halten sich CDU, CSU und FDP bisher weiterhin bedeckt und bekennen sich lediglich zu einem „fairen Wahlkampf“. Die Selbstverpflichtung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist eigentlich eine gute Grundlage für einen ausbaufähigen Konsens aller Parteien. Dass es keine überparteiliche Selbstverpflichtung gibt, zeigt wiederum, dass weiterhin unterschiedliche Vorstellungen der Parteien von einer Regulierung ihrer Netzaktivitäten vorherrschen.
Netzwerkdurchsetzungsgesetz 3.0?
Diese Uneinigkeit setzt sich in den Wahlprogrammen fort. Während die SPD eine Weiterentwicklung der Schutzvorschriften im Strafgesetzbuch und des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) ankündigt, fordert die FDP eine Abschaffung des NetzDG und den Ersatz durch einen Regulierungsmix. Dieser soll den Schutz der Meinungsfreiheit in vollem Umfang gewährleisten, indem der Einfluss sozialer Netzwerke durch Einrichtungen der Selbstregulierung als Beschwerdeinstanz verringert wird. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE klammern wiederum das NetzDG gänzlich aus und versprechen stattdessen ein Gesetz für digitalen Gewaltschutz beziehungsweise die juristische Anerkennung und Verfolgung von digitaler Gewalt im Netz. Laut BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN soll das neue Gesetz die Möglichkeit bieten, gegen Accounts vorzugehen, wenn keine Täterin oder Täter festgestellt wird. Außerdem sollen im Gesetz auch die Haftbarkeit der Plattformbetreiber für eigene Inhalte sowie die Wahrung der Grundrechte bei der Inhalte-Moderation gebündelt werden. Die Wahrung der Grundrechte will auch die CDU/CSU durch eine Anpassung des Rechts der AGBs sicherstellen. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Union weiter am NetzDG festhalten wird, selbst wenn das NetzDG nicht ausdrücklich in ihrem Wahlprogramm erwähnt wird.
Identifizierbarkeit weiter Streitthema
Neben dem grundsätzlichen regulatorischen Rahmen existiert außerdem Uneinigkeit in der Frage nach der Identifizierbarkeit im digitalen Raum. Zwar sind sich die Parteien weitgehend einig hinsichtlich einer Aufwertung der Strafverfolgung. Doch scheiden sich die Meinungen beim Umgang mit Nutzeridentitäten. Während Anreize zur Klarnamennutzung oder gar eine Klarnamenpflicht innerhalb der CDU/CSU diskutiert werden, lehnt die SPD letztere in ihrem bereits veröffentlichten Wahlprogramm entschieden ab. Stattdessen will sie sich für eine pseudonyme Nutzung und die Verpflichtung von Plattformbetreibern zur Schaffung von Voraussetzungen für eine grundsätzliche Identifizierbarkeit einsetzen. Die FDP präferiert wiederum einen Auskunftsanspruch der Opfer von Straftaten im Netz gegenüber Plattformen und Internetprovidern. Eine Ausweispflicht für E-Mail und Messenger-Dienste lehnt DIE LINKE genauso ab, wie die Vorratsdatenspeicherung von IP-Verbindungen oder eine Impressumspflicht für Internetseiten. Damit zeigt sich die Brisanz der Frage nach der Identifizierbarkeit: Für die einen setzt Demokratie eine Zuschreibung von Meinungsbeiträgen voraus, für die anderen bietet Anonymität erst die Voraussetzung für Meinungsfreiheit und Demokratie.
Gerichte entscheiden mit
Die Identifizierbarkeit im Netz ist längst auch eine juristische Angelegenheit. Erst Ende 2020 entschied das Oberlandesgericht München, dass Facebook Pseudonyme weiterhin verbieten dürfe. Die RichterInnen argumentieren, die Verpflichtung zur Verwendung des echten Namens sei geeignet, um User von rechtswidrigem Verhalten im Internet abzuhalten. Dass der Effekt einer Klarnamennutzung auf Hass und Hetze im Netz allerdings nur gering ausfällt, haben erste wissenschaftliche Studien bereits gezeigt. Bei der Bestandsdatenauskunft stellte sich das Bundesverfassungsgericht bisher schützend vor die informationelle Selbstbestimmung der User. So musste auch die gesetzliche Verpflichtung der Anbieter sozialer Netzwerke, bestimmte Inhalte wie die Androhung oder Billigung von Straftaten plus IP-Adresse und Port-Nummer ans BKA zu melden, durch neue Regelungen zu Bestandsdaten „repariert“ werden. Trotzdem sind auch hier weitere Gerichtsverfahren in den nächsten Jahren möglich.
Die fortlaufende juristische Korrektur verdeutlicht auch das Dilemma der Beteiligten: Zum einen bedrohen Hass und Hetze im Netz die Grundfeste unserer Demokratie. Zum anderen sind Meinungsfreiheit und informationelle Selbstbestimmung hohe Güter in der Demokratie. In der nächsten Legislatur werden Gesetzgeber, Unternehmen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft daher weiter an einer verhältnismäßigen Lösung arbeiten müssen, die effektiv Hass und Hetze bekämpft.